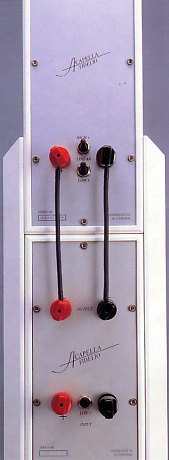|
|
HIFI exclusiv 3/92
LAUTSPRECHER
A Capella Audio Arts Fidelio, High
Fidelio, High Fidelio Baßmodul |
 lfred
Rudolph zählt zu den bekanntesten Pionieren der deutschen High-End-Szene. Er hat
eines der weltbesten, größten und schönsten Lautsprechersysteme der Welt geschaffen.
Um dessen gigantische Kugelwellenhörner zu bestaunen, haben sich Tausende während
der letzten Funkausstellungen die Nasen an den Schaufenstern des BMW-Pavillons
platt gedrückt. Man muß aber kein Millionär sein, um einen echten Rudolph mit
fast allen typischen, klanglichen und optischen Reizen zu besitzen.Den HiFi-Perfektionisten
reizt es nämlich auch, aus dem bei Audiophilen beliebten Zweiwegsystem das Maximum
herauszukitzeln. Damit alle von seiner Arbeit profitieren können, gibt es seinen
Kleinen als Grundmodell Fidelio und als getunte Variante High Fidelio. Für höhere
Ansprüche an die Tielbaßwiedergabe kann man beide Boxen mit akustisch und optisch
optimal angepaßten Subwoofern aufwerten. Der Fidelio kostet einschließlich Fußgestell
5200 Mark pro Paar. Die High-Version ist 5340 Mark teurer. Die Baßmodule schlagen
mit 7200, beziehungsweise 12000 Mark zu Buche. Nachträgliche Hochrüstungen sind
nur geringfügig teurer als der sofortige Erwerb des Spitzenmodells. Gegen Aufpreis
sind alle erdenklichen Holz- und Farbvarianten erhältlich. Besonders gut haben
mir die transparenten Acrylgestelle gefallen. Dieses Edeldesign kostet aber leider
4900 Mark mehr. Die genannten Preise sind nicht gering. Man muß jedoch bedenken,
daß es sich hier um edel verarbeitete, besonders schöne Schmuckstücke handelt.
Wenn ich in ein Möbelhaus gehe und die Preisschilder vergleichbar schöner Exemplare
lese, kommen mir die Fidelios gar nicht mehr teuer vor. "Nebenbei" klingen
die Edelboxen so lebendig, daß selbst ein abgeklärter Testjournalist wie ich vor
Freude lacht. lfred
Rudolph zählt zu den bekanntesten Pionieren der deutschen High-End-Szene. Er hat
eines der weltbesten, größten und schönsten Lautsprechersysteme der Welt geschaffen.
Um dessen gigantische Kugelwellenhörner zu bestaunen, haben sich Tausende während
der letzten Funkausstellungen die Nasen an den Schaufenstern des BMW-Pavillons
platt gedrückt. Man muß aber kein Millionär sein, um einen echten Rudolph mit
fast allen typischen, klanglichen und optischen Reizen zu besitzen.Den HiFi-Perfektionisten
reizt es nämlich auch, aus dem bei Audiophilen beliebten Zweiwegsystem das Maximum
herauszukitzeln. Damit alle von seiner Arbeit profitieren können, gibt es seinen
Kleinen als Grundmodell Fidelio und als getunte Variante High Fidelio. Für höhere
Ansprüche an die Tielbaßwiedergabe kann man beide Boxen mit akustisch und optisch
optimal angepaßten Subwoofern aufwerten. Der Fidelio kostet einschließlich Fußgestell
5200 Mark pro Paar. Die High-Version ist 5340 Mark teurer. Die Baßmodule schlagen
mit 7200, beziehungsweise 12000 Mark zu Buche. Nachträgliche Hochrüstungen sind
nur geringfügig teurer als der sofortige Erwerb des Spitzenmodells. Gegen Aufpreis
sind alle erdenklichen Holz- und Farbvarianten erhältlich. Besonders gut haben
mir die transparenten Acrylgestelle gefallen. Dieses Edeldesign kostet aber leider
4900 Mark mehr. Die genannten Preise sind nicht gering. Man muß jedoch bedenken,
daß es sich hier um edel verarbeitete, besonders schöne Schmuckstücke handelt.
Wenn ich in ein Möbelhaus gehe und die Preisschilder vergleichbar schöner Exemplare
lese, kommen mir die Fidelios gar nicht mehr teuer vor. "Nebenbei" klingen
die Edelboxen so lebendig, daß selbst ein abgeklärter Testjournalist wie ich vor
Freude lacht.

 chon
das Grundmodell hat mir mit seinem Temperament und seiner Transparenz viel Spaß
gemacht. Es verfügt auch meßtechnisch gesehen über ein extrem gutes Impulsverhalten.
Mit seiner geringen Phasendrehung von gut 100 Grad im gesamten Übertragungsbereich
können nur die wenigsten Konkurrenten mithalten. Diese Konstruktion erfüllt endlich
das gängige High-End-Versprechen eines glatten Phasenübergangs zwischen Hoch-
und Mitteltöner. Das größere Chassis hinkt nur 0,07 Millisekunden hinterher. Dabei
stand A Capella zum Zeitpakt der Entwicklung noch gar nicht das auch von mir benutzte
MLSSA-Computersystcm zur Messung des Phasengangs zur Verfügung. Die phasengenaue
Abstimmung gelang allein mit Hilfe goldener Ohren, richtiger Überlegungen und
kontrollierender Messungen mit konventioneller Technik. Die Weiche nutzt den normalen
Frequenzgangabfall der Chassis, um vor allem im Übergangsbereich mit möglichst
flachen Filtern auszukommen. chon
das Grundmodell hat mir mit seinem Temperament und seiner Transparenz viel Spaß
gemacht. Es verfügt auch meßtechnisch gesehen über ein extrem gutes Impulsverhalten.
Mit seiner geringen Phasendrehung von gut 100 Grad im gesamten Übertragungsbereich
können nur die wenigsten Konkurrenten mithalten. Diese Konstruktion erfüllt endlich
das gängige High-End-Versprechen eines glatten Phasenübergangs zwischen Hoch-
und Mitteltöner. Das größere Chassis hinkt nur 0,07 Millisekunden hinterher. Dabei
stand A Capella zum Zeitpakt der Entwicklung noch gar nicht das auch von mir benutzte
MLSSA-Computersystcm zur Messung des Phasengangs zur Verfügung. Die phasengenaue
Abstimmung gelang allein mit Hilfe goldener Ohren, richtiger Überlegungen und
kontrollierender Messungen mit konventioneller Technik. Die Weiche nutzt den normalen
Frequenzgangabfall der Chassis, um vor allem im Übergangsbereich mit möglichst
flachen Filtern auszukommen.
 ie
Früchte dieses Designs ernteten wir im Hörtest. Dort beeindruckte der Fidelio
mit schnelleren Impulsanstiegen und größerer Präzision im Grundtonbereich als
der Genesis IM 8300 und der viel teurere Avalon Ascent MK II. Hierzu trägt auch
die Abstimmung des Baßreflexgehäuses für das Focal-Chassis entscheidend bei. Es
weicht bewußt von den Erfahrungswerten der Herren Thiele und Small ab, um ein
besseres Verhalten im Zeitbereich zu erreichen. Diese Auslegung führt auch zu
einem im Vergleich zu den meisten anderen Lautsprechern weniger aufgedickten,
sauberen Klang. ie
Früchte dieses Designs ernteten wir im Hörtest. Dort beeindruckte der Fidelio
mit schnelleren Impulsanstiegen und größerer Präzision im Grundtonbereich als
der Genesis IM 8300 und der viel teurere Avalon Ascent MK II. Hierzu trägt auch
die Abstimmung des Baßreflexgehäuses für das Focal-Chassis entscheidend bei. Es
weicht bewußt von den Erfahrungswerten der Herren Thiele und Small ab, um ein
besseres Verhalten im Zeitbereich zu erreichen. Diese Auslegung führt auch zu
einem im Vergleich zu den meisten anderen Lautsprechern weniger aufgedickten,
sauberen Klang.
In Verbindung mit den kompromißlos auf korrektes Impulsverhalten getrimmten Subwoofern
war die Wiedergabe in meinem Raum aber etwas zu schlank. Dieser Eindruck entsteht wohl
durch die Abstimmung der zugehörigen Frequenzweiche, die den Schallpegel zwischen 100 und
400 Hertz im Vergleich zum Zweiwegbetrieb um durchschnittlich zwei Dezibel verringert. Der
kühle Charakter läßt sich kompensieren. Hierzu kann man mit einem kleinen Schalter die
der Resonanzbedämpfung dienende Gegenkopplung der zweiten Focal-Schwingspule ausschalten.
Darunter leidet aber geringfügig die Kontrolliertheit der Tieftonwiedergabe.
Die genau in die Fußgestelle passenden
Tiefbaßeinheiten erweitern den bei etwa 55 Hertz endenden unteren Übertragungsbereichs
des Zweiwegsystems um 20 Hertz. Damit reichen sie zwar weniger weit hinunter als große
ServoWoofer, doch bei den meisten Musikstücken beeindrucken die schlanken, schönen
Wandler mit einem äußerst präzisen und profunden Tiefbaßfundament. Wer den Fußboden
beben lassen will, muß sich nach einem anderen, nicht so gut ausschauenden und weitaus
schwieriger akustisch anpaßbaren Subwoofer umschauen.
 |
|
Mit der Steinhaube "Pharaoh" kann man
restliche, durch die Arbeit des Schallwandlers erzeugte mechanische Unruhen wirkungsvoll
bedämpfen. Dieses Tuning führt zu einer weiteren Steigerung der Wiedergabe-Präzision
des transparenten, dynamischen Lautsprechers |
 it
dem tonalen Mitteltoncharakter war ich anfangs unzufrieden. Deshalb hat sich der
Test der Lautsprecher etwas verzögert. Sie zieren bereits über ein Jahr meinen
Hörraum, wo sie mit ihrer schonungslosen Offenheit manch anderem Testkandidaten
auf den Zahn gefühlt haben. Alfred Rudolph hatte versucht, einen typischen High-End-Traum
zu realisieren und auf Dämpfungsmaterial zu verzichten. Statt der Energie fressenden
Matten sollte ein geschickt im Gehäuse positionierter "Diffusor", ein
schräg montierter Stab mit fünf Zentimeter Durchmesser, das klangbeeinträchtigende
akustische Innenleben unterbinden. Daß dies nicht völlig gelungen war, zeigte
ein vor allem bei Stimmenwiedergabe störender, topfiger Klang. Es vergingen aber
nur ein paar Monate bis der Chef-Designer von A Capella Audio Arts die Stäbe in
der Fidelio und in den Baßeinheiten durch etwas Watte ersetzte. it
dem tonalen Mitteltoncharakter war ich anfangs unzufrieden. Deshalb hat sich der
Test der Lautsprecher etwas verzögert. Sie zieren bereits über ein Jahr meinen
Hörraum, wo sie mit ihrer schonungslosen Offenheit manch anderem Testkandidaten
auf den Zahn gefühlt haben. Alfred Rudolph hatte versucht, einen typischen High-End-Traum
zu realisieren und auf Dämpfungsmaterial zu verzichten. Statt der Energie fressenden
Matten sollte ein geschickt im Gehäuse positionierter "Diffusor", ein
schräg montierter Stab mit fünf Zentimeter Durchmesser, das klangbeeinträchtigende
akustische Innenleben unterbinden. Daß dies nicht völlig gelungen war, zeigte
ein vor allem bei Stimmenwiedergabe störender, topfiger Klang. Es vergingen aber
nur ein paar Monate bis der Chef-Designer von A Capella Audio Arts die Stäbe in
der Fidelio und in den Baßeinheiten durch etwas Watte ersetzte.
| Hinter dem Tiefmitteltöner erkennt man eine Verstrebung.
Diese Besonderheit des High Fidelio bietet den Beschleunigungskräften der Schwingspule
ein sicheres Widerlager. Das optimale Anzugsmoment der Verschraubung wird per Gehör
eingestellt |
|
 |
Solche Dämfungsmaßnahmen wirken in erster Linie auf die
Tieftonresonanz. Erwartungsgemäß konnte ich oberhalb von 100 Hertz deshalb weder
im Frequenzgang noch im Abklingspektrum meßtechnische Veränderungen erkennen. Dennoch
wirkte sich das Ganze gehörmäßig sehr vorteilhaft aus. Nach dieser Kur sanken die
Verfärbungen auf ein kaum noch auffallendes, nicht mehr störendes Minimalmaß. Ein
kleiner Rest von Boxenklang geht wahrscheinlich auf das Konto einer
Unregelmäßigkeit im sonst äußerst vorbildlichen Frequenzgang bei knapp 500 Hertz, die
sich auch in der Impedanzkurve bemerkbar macht.
| Ein aus dem Vollen gedrehter, 2,5 Kilogramm schwerer
Messingring hält den Treiber des Baßmoduls. Die hochglänzend polierte, platinierte
Oberfläche kann gegen Aufpreis auch passend zur Front lackiert werden |
|
 |
Die Höhenwiedergabe verläuft meßtechnisch mit 30 Grad seitlicher
Mikrofonposition am linearsten. Wie die meisten anderen Boxen brachte der Fidelio dann
auch mit einer sehr geringen Anwinkelung auf den Hörplatz die besten Ergebnisse. Dabei
tat sich die Höhenwiedergabe anfangs in meinem schwach bedämpften Raum etwas zu sehr
hervor. Mit den Schaltern zur Raumanpassung konnte ich diese Eigenart nicht völlig
beseitigen. So mußte Alfred Rudolph noch einmal Anreisen und den oberen Frequenzbereich
durch die Herausnahme zweier für solche Extremfälle vorgesehenen Widerstände weiter
absenken. Danach besaßen die Violinen jenes berühmte, silbrige Strahlen, ohne metallisch
zu nerven.
 en
bei 2500 Hertz einsetzenden Hochtöner baut Dynaudio nur noch für A Capella Audio
Arts. Bis auf eine klanglich kaum bedeutsame Resonanz bei 16 Kilohertz
läßt er sich meßtechnisch kaum Fehler nachweisen. Zur akustisch und optisch optimalen
Anpassung an die Schallwand läßt Rudolph für den auf Ohrhöhe unter dem Mitteltöner
angeordneten Wandler eine Art Hornverlängerung drehen. Eine Abdeckung schützt
den Treiber vor den Schallwellen im Gehäuseinneren. Im Hörtest zeigte sich, daß
die dänische Kalotte bestens mit dem französischen Kollegen harmoniert. Änderungen
des Klangcharakters beim Übergang von einem auf das andere Chassis konnte ich
nicht feststellen. Es gibt heute ein paar High-Tech-Wandler, zum Beispiel von
Genesis und Outsider, die noch luftiger, detailreicher, etwas samtiger und bei
extremen Pegeln weniger angestrengt arbeiten. Angesichts der Homogenität des Fidelio
lassen sich in diesen Punkten Nachteile jedoch verschmerzen. en
bei 2500 Hertz einsetzenden Hochtöner baut Dynaudio nur noch für A Capella Audio
Arts. Bis auf eine klanglich kaum bedeutsame Resonanz bei 16 Kilohertz
läßt er sich meßtechnisch kaum Fehler nachweisen. Zur akustisch und optisch optimalen
Anpassung an die Schallwand läßt Rudolph für den auf Ohrhöhe unter dem Mitteltöner
angeordneten Wandler eine Art Hornverlängerung drehen. Eine Abdeckung schützt
den Treiber vor den Schallwellen im Gehäuseinneren. Im Hörtest zeigte sich, daß
die dänische Kalotte bestens mit dem französischen Kollegen harmoniert. Änderungen
des Klangcharakters beim Übergang von einem auf das andere Chassis konnte ich
nicht feststellen. Es gibt heute ein paar High-Tech-Wandler, zum Beispiel von
Genesis und Outsider, die noch luftiger, detailreicher, etwas samtiger und bei
extremen Pegeln weniger angestrengt arbeiten. Angesichts der Homogenität des Fidelio
lassen sich in diesen Punkten Nachteile jedoch verschmerzen.
In der Zwischenzeit ist es allgemein bekannt, daß die besten Chassis und
Frequenzweichen nichts nutzen, wenn das Gehäuse vibriert. Jeder Boxenbauer achtet deshalb
auf die mechanische Unempfindlichkeit seiner Konstruktion. Beim Fidelio überschreitet der
zur Stabilisierung getriebene Aufwand das Übliche bei weitem. So werden die fest
verschraubten Rückwände aus steifen Metallplatten gefertigt und bei der tief glänzenden
Schallwand handelt es sich um eine akustisch tote Acryl-Holz-Konstruktion. Ein technischer
und optischer Leckerbissen ist der aus dem Vollen gedrehte, hochglänzend platinierte
Messinghalter für das Chassis im Baßmodul. Bei unserer High-Version war er passend zur
Front lackiert. Mit seinen 2,5 Kilogramm läßt sich das schöne Teil von den
Beschleunigungen des Tieftöners kaum aus der Ruhe bringen.
 |
|
Bis auf eine auch in der Impedanzkurve auffallende Resonanz
bei knapp 500 Hertz verläuft der quasischalltote Frequenzgang (obere Abbildung,
meßtechnische Auflösung 100 Hertz) vorbildlich linear. Die gepunktete Kurve wurde mit 30
Grad seitlicher Mikrofonposition aufgezeichnet. Das zweite Diagramm zeigt die im Nahfeld
gemessene Tieftonwiedergabe des Baßmoduls. Die drei gepunkteten Linien gelten für den
Betrieb mit Baßanhebung und die entsprechenden Messungen für das Zweiwegsystem. Der
Phasengang zeigt den besten Verlauf, den wir bisher für eine Box gemessen haben. Das
untere Impedanz-Diagramm gilt für die High Fidelio mit Baßmodul und
Tiefton-Gegenkopplung mit Hilfe der zweiten Schwingspule. Ohne diese Schaltung sind die
Baßresonanzen stärker ausgeprägt |
 ie
Tugenden des Fidelio boten dem nimmermüden Experimentator Alfred Rudolph eine
ideale Basis für seine typischen Optimierungsansätze. Bei einer so hoch auflösenden,
transparenten Box macht sich jede Verbesserung viel deutlicher bemerkbar als bei
einem "Weichzeichner". So entstand der High Fidelio. Erstens ist dessen
Tiefmitteltöner zur Versteifung mit den Gehäusewänden verschraubt. Das optimale
Anzugsmoment findet ein Spezialist per Gehörs. Ähnlich wie bei der manuellen Scharfstellung
eines Objektivs verändert er das Anzugsmoment bei gleichzeitigem Abhören eines
gleitenden Sinussignals, bis der Klang am saubersten ist. Zweitens muß die Acryl-Holz-Schallwand
einem noch steiferen Messing-Holz-Sandwich weichen. ie
Tugenden des Fidelio boten dem nimmermüden Experimentator Alfred Rudolph eine
ideale Basis für seine typischen Optimierungsansätze. Bei einer so hoch auflösenden,
transparenten Box macht sich jede Verbesserung viel deutlicher bemerkbar als bei
einem "Weichzeichner". So entstand der High Fidelio. Erstens ist dessen
Tiefmitteltöner zur Versteifung mit den Gehäusewänden verschraubt. Das optimale
Anzugsmoment findet ein Spezialist per Gehörs. Ähnlich wie bei der manuellen Scharfstellung
eines Objektivs verändert er das Anzugsmoment bei gleichzeitigem Abhören eines
gleitenden Sinussignals, bis der Klang am saubersten ist. Zweitens muß die Acryl-Holz-Schallwand
einem noch steiferen Messing-Holz-Sandwich weichen.
 ie
ohnehin strenge Eingangskontrolle der Focal-Chassis, die bei über der Hälfte der
Liefermenge eine Nachbesserung oder gar Rücksendung notwendig macht, ist für die
"High-Typen" noch schärfer. Sie müssen wesentlich höhere Schallpegel
verkraften, ohne die geringsten Geräusche zu erzeugen. Die Weiche wird mit noch
besseren, enger tolerierten Bauteilen bestückt. Die Innenverkabelung des High
Fidelio besteht aus Silber und ist mit Keramikperlen isoliert. Die Leitungen werden
ohne Unterbrechung zur Außenseite der reinkupfernen Polklemmen geführt. Wenn man
dort das identisch aufgebaute Lautsprecherkabel von A Capella befestigt, liegt
Silber auf Silber. Ein kräftiger Dreh an der Schraube genügt, die Kontaktzone
luftdicht zu verschließen. So hat die Korrosion nur wenig Angriffschancen. ie
ohnehin strenge Eingangskontrolle der Focal-Chassis, die bei über der Hälfte der
Liefermenge eine Nachbesserung oder gar Rücksendung notwendig macht, ist für die
"High-Typen" noch schärfer. Sie müssen wesentlich höhere Schallpegel
verkraften, ohne die geringsten Geräusche zu erzeugen. Die Weiche wird mit noch
besseren, enger tolerierten Bauteilen bestückt. Die Innenverkabelung des High
Fidelio besteht aus Silber und ist mit Keramikperlen isoliert. Die Leitungen werden
ohne Unterbrechung zur Außenseite der reinkupfernen Polklemmen geführt. Wenn man
dort das identisch aufgebaute Lautsprecherkabel von A Capella befestigt, liegt
Silber auf Silber. Ein kräftiger Dreh an der Schraube genügt, die Kontaktzone
luftdicht zu verschließen. So hat die Korrosion nur wenig Angriffschancen.
 |
|
Die freie Verdrahtung der Frequenzweiche sieht zwar nicht
besonders schön aus. Sie hat sich bei High-End-Boxen aus klanglichen Gründen jedoch
durchgesetzt. Die Weiche verhilft dem Zweiwegesystem zur geringsten Phasendrehung, die wir
bisher bei einer Box gemessen haben |
 as
silberne Kabel möchte ich Ihnen wärmstens empfehlen. Es ist der beste Partner,
den ich für die High Fidelio und manch anderen Lautsprecher finden konnte. Vor
allem seine exzellente Sauberkeit in Verbindung mit extremer Auflösung im oberen
Frequenzbereich hat mich beeindruckt. Die typisch silbrige Aura der Höhen ist
mir bei ihm nicht unangenehm aufgefallen. Gegenüber den meisten Kupferkabeln gewinnt
die Wiedergabe an Natürlichkeit und Plastizität. Vorher kaum bemerkte Reste technischer
Rauhigkeiten sind plötzlich verschwunden. as
silberne Kabel möchte ich Ihnen wärmstens empfehlen. Es ist der beste Partner,
den ich für die High Fidelio und manch anderen Lautsprecher finden konnte. Vor
allem seine exzellente Sauberkeit in Verbindung mit extremer Auflösung im oberen
Frequenzbereich hat mich beeindruckt. Die typisch silbrige Aura der Höhen ist
mir bei ihm nicht unangenehm aufgefallen. Gegenüber den meisten Kupferkabeln gewinnt
die Wiedergabe an Natürlichkeit und Plastizität. Vorher kaum bemerkte Reste technischer
Rauhigkeiten sind plötzlich verschwunden.
Auch sonst zieht der Fidelio ganzheitliche, zu Wärme
und Fülle tendierende Partner kühlen Analytikern vor. Er ist selber so schnell und
durchsichtig, daß mir ausnahmsweise der eigentlich weniger präzise Pentoden-Betrieb der
MFA M200 besser gefallen hat. Mit diesen wunderbaren Röhren-Monos klingen die Duisburger
High-End-Kreationen in meiner Anlage am natürlichsten. Sie wirken zwar nicht so
detailversessen wie die Mark Levinson No. 20.5, erwecken aber einen stärkeren Eindruck
räumlicher Geschlossenheit. Bei entsprechend guten Aufnahmen stellen sie die körperlich
glaubwürdig nachgezeichneten Orchesterstimmen mit dem Hörer in einen akustisch homogenen
Raum.
Die hohe Maximalleistung der großen M200 wird auch benötigt, wenn man die
erstaunliche Pegelfestigkeit des High Fidelio nutzen will. Für 90 Dezibel in einem Meter
Abstand verlangt er bereits plusminus 6,4 Volt. Diese Spannung entspricht an fünf Ohm
etwa vier Watt. Mit den MFA und den No. 20.5 erreichte der kleine Lautsprecher in vier
Meter Abstand saubere Pegel von über 100 Dezibel. Er kann so laut und dynamisch
aufspielen, daß man glaubt, einen viel größeren Lautsprecher vor sich zu haben. Der
unvermeidbare Unterschied zu einem Riesensystem mit großen Wandlerflächen liegt nur in
der Fähigkeit, den ganzen Raum mit Musik zu füllen.
 ie
High-Hochrüstung macht aus dem Fidelio keinen völlig neuen Lautsprecher. Der Charakter
bleibt erhalten. Nur die Stärken treten noch ausgeprägter hervor. Die Wiedergabe
gewinnt deutlich an Verzerrungsarmut und Durchsichtigkeit. Doch das Niveau läßt
sich noch steigern. Wir sind in einen Bereich vorgestoßen, in dem jede
Kleinigkeit eine Rolle spielt. ie
High-Hochrüstung macht aus dem Fidelio keinen völlig neuen Lautsprecher. Der Charakter
bleibt erhalten. Nur die Stärken treten noch ausgeprägter hervor. Die Wiedergabe
gewinnt deutlich an Verzerrungsarmut und Durchsichtigkeit. Doch das Niveau läßt
sich noch steigern. Wir sind in einen Bereich vorgestoßen, in dem jede
Kleinigkeit eine Rolle spielt.
Eine sorgfältig ausgesuchte, möglichst freie Aufstellung im Raum ist selbstverständlich
eine Grundvoraussetzung für die Klanggüte, von der hier die Rede ist. Um die
Standsicherheit haben Sie sich wahrscheinlich auch schon immer gekümmert. Sie wird nun
aber noch wichtiger. Die geringsten Bewegungen der Boxengehäuse gilt es zu vermeiden. Da
sich Fußböden unterschiedlich verhalten, gibt es keine allgemeingültige Empfehlung für
den optimalen Unterbau. Auf meinem Holzboden mit Trockenschüttung brachte die Aufstellung
mit Hilfe von Spikes auf einer schweren, vom Boden ebenfalls mit Spikes entkoppelten
Granitplatte das beste Ergebnis.
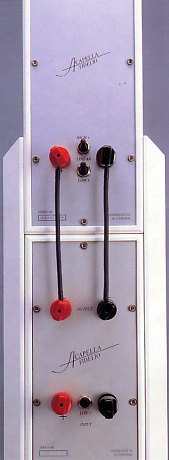 |
|
Die Baßmodule enthalten eine Weiche für die
geänderte Ansteuerung des Zweiwegesystems, das mit den oberen, reinkupfernen Klemmen
verbunden wird. Für den High Fidelio verwendet man am besten das mit Keramikperlen
isolierte, silberne Lautsprecherkabel von A Capella Audio Arts. Es hat direkten Kontakt
mit der nach außen geführten, gleichartigen Innenverkabelung der Box |
 erfektionisten
können noch mehr erreichen, wenn sie die Box mit einer schweren Last beruhigen.
Damit die Optik nicht darunter leidet, hat Alfred Rudolph den Pharaoh für den
Fidelio entworfen. Da er die schmucke Steinhaube nicht selbst fertigen und kostengünstig
anbieten kann, hat er nur zwei Musterexemplare bauen lassen. Interessierte Kunden
können kostenlos die Konstruktionszeichnung anfordern und damit zum nächsten Steinmetz
gehen. erfektionisten
können noch mehr erreichen, wenn sie die Box mit einer schweren Last beruhigen.
Damit die Optik nicht darunter leidet, hat Alfred Rudolph den Pharaoh für den
Fidelio entworfen. Da er die schmucke Steinhaube nicht selbst fertigen und kostengünstig
anbieten kann, hat er nur zwei Musterexemplare bauen lassen. Interessierte Kunden
können kostenlos die Konstruktionszeichnung anfordern und damit zum nächsten Steinmetz
gehen.
Ich wollte es erst nicht glauben, doch der Pharaoh
brachte einen für die Menschheit kleinen, für den High-Ender aber großen Schritt in
Richtung Wahrheit. Die Möglichkeiten des kleinen Systems begannen mich ebenso zu
faszinieren, wie seinen geistigen Vater. So war es schließlich nur eine Frage der Zeit,
bis ich die Endstufen abwechselnd direkt mit der Phonovorstufe Mark Levinson No. 25S und
dem Super-D/A-Wandler No. 30 koppelte: Welch ein Gewinn, welch ein Spaß! Endlich schien
alles Machbare erreicht.
Ein paar Abende lang konnte ich die herrliche Musik genießen, ohne an
die weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu denken. Danach drängte schon wieder der
nächste Testkandidat. So entfloh ich gezwungenermaßen der Sucht nach der Verbesserung
des Erreichten, die allen Audiophilen gleichzeitig so viel Leiden und Vergnügen schafft
und die sich mit den Fidelios so wunderbar ausleben läßt.
Startseite
Zurück
|